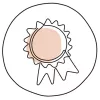
Demenzfreundliche Apotheke
Das Projekt "Demenzfreundliche Apotheke" zielt darauf ab, Apotheken partizipativ mit den dort Beschäftigen, Menschen mit Demenz und betreuenden Angehörigen so weiterzuentwickeln, dass sie den Bedürfnissen von Menschen mit Demenz und Angehörigen gerecht werden und ihnen eine unterstützende gesundheitsförderliche Umgebung bieten.
Im Pilotprojekt „Demenzfreundliche Apotheke“ haben sich Apotheken aus Wien und Niederösterreich, Vertreter:innen der Selbsthilfegruppen Alzheimer Austria, betreuende Angehörige, Vertreter:innen der Apothekerkammer und Wissenschaftler:innen zusammengefunden. Konzeptuell der partizipativen Gesundheitsforschung folgend wurde gemeinsam erforscht und erprobt, wie Apotheken demenzfreundlich gestaltet werden können. Dabei standen zwei Ebenen im Fokus: Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter:innen, sowie Entwicklungen und Anpassungen auf Ebene der Organisation.
Im Rahmen des Auftaktworkshops mit Mitarbeiter:innen der beteiligten Apotheken wurden Betreuungsgeschichten ausgetauscht, um vorhandene Ressourcen und hilfreiche Handlungsweisen sichtbar zu machen und zu teilen. In einer anschließenden Workshopreihe setzten sich die Mitarbeiter:innen – begleitet von Expert:innen – mit folgenden Fragen auseinander:
- Was bedeutet gute Kommunikation mit Menschen mit Demenz und betreuenden Angehörigen?
- Mit welchen Beratungs- und Unterstützungseinrichtungen können Apotheken zusammenarbeiten?
- Welche spezifischen Herausforderungen ergeben sich in der pharmazeutischen Betreuung von Menschen mit Demenz?
Betreuende Angehörige waren in allen Workshops als Erfahrungsexpert:innen beteiligt. Um das Gelernte zu erproben, entwickelten und setzten die Apotheken im Rahmen von Praxisprojekten Maßnahmen um. Diese Praxisprojekte konzentrierten sich auf folgende drei Bereiche: Sichtbarkeit und Entstigmatisierung, Wissen und Information, sowie kommunale Vernetzung. Im Pilotprojekt „Demenzfreundliche Apotheke“ stand die gemeinsame Entwicklung der Workshopreihe und ausgewählter Praxisprojekte im Mittelpunkt. In den darauffolgenden Projekten „Demenzfreundliche Apotheke Stadt Salzburg“ und „Lebendig – Leben mit Demenz in der Gemeinde“ wurde der Fokus erweitert:
- auf das kommunale Setting (Stadt Salzburg)
- auf Apotheken als Gesundheitseinrichtungen in der Region (Oststeiermark)
- erstmals Einbindung einer Person mit Demenz als Erfahrungsexpert:in (Projekt „Lebendig“)
Als Projektprodukte wurden ein Logo entworfen und eine Broschüre entwickelt, die in der dritten, überarbeiteten Auflage online verfügbar ist und zentrale Projektergebnisse dokumentiert. Über zwei Jahre hinweg war zudem das Netzwerk „Demenzfreundliche Apotheke“ als Austauschforum aktiv.
Erfüllte Good Practice Kriterien
- Spezialkriterium: Gesundes Altern
- Qualitätskriterien der Gesundheitsförderung
- Übertragbarkeit und Weiterentwicklung
- Wirkannahme & -modell
- Evaluation der Wirksamkeit
Problembeschreibung
Demenz stellt eine der größten gesundheitspolitischen Herausforderungen unserer alternden Gesellschaft dar. In Österreich leben derzeit rund 120.000 Menschen mit einer demenziellen Erkrankung – das entspricht einer Prävalenz von etwa 1,15–1,27 %. Zwei Drittel der Betroffenen sind Frauen, was auf die höhere Lebenserwartung und das steigende Erkrankungsrisiko im Alter zurückzuführen ist (1. Österreichischer Demenzbericht). Etwa 80 % der Menschen mit Demenz werden im häuslichen Umfeld betreut – überwiegend von älteren weiblichen Angehörigen. Diese übernehmen eine Vielzahl an Aufgaben, die sie häufig rund um die Uhr beanspruchen. Die Belastung ist hoch: physisch, psychisch und sozial. Gleichzeitig fehlt es oft an frühzeitiger Information, Beratung und Entlastung. Unterstützungsangebote erreichen die Betroffenen häufig zu spät oder sind schwer zugänglich. Auch die Bedürfnisse der Menschen mit Demenz selbst werden zunehmend sichtbar. Neben medizinischer Versorgung und Betreuung stehen Wünsche nach Selbstbestimmung, sozialer Teilhabe und einem Leben in vertrauter Umgebung im Vordergrund. Die Perspektive, Demenz als Behinderung zu verstehen, lenkt den Fokus auf strukturelle Barrieren und die Notwendigkeit, Lebenswelten inklusiv zu gestalten.
Ein zentrales, bislang wenig genutztes Setting sind öffentliche Apotheken. Sie zählen – neben Hausärztinnen und -ärzten – zu den häufigsten Anlaufstellen für Betroffene und Angehörige, insbesondere in frühen Krankheitsphasen. Apotheken bieten damit ein großes Potenzial für niederschwellige Information, Früherkennung und Weitervermittlung.